
von Tine Nowak | Jul 31, 2020 | Allgemein
Im Rahmen des Seminars zu “Digitalen Gesprächsräume” im Orientierungsstudium der Goethe Universität Frankfurt sind Essays zur subjektorientierter Erzählung von digitalen Praxen und Phänomenen entstanden. Mehr dazu findet sich auf der Überblicksseite: Digitale Gesprächsräume.
Identität
Essay von Alina Aybar
Instagram ist eine kostenlose App zum Teilen, liken und kommentieren von Fotos und Videos. Mithilfe der App kann man von seinem Smartphone Bilder und Videos aufnehmen, mit Filtern bearbeiten und anschließend im Netzwerk hochladen, um sie mit seinen Freunden zu teilen. Man kann sie mit der ganzen Welt teilen, nur den ausgewählten Follower*innen oder lediglich einigen engen Freund*innen. Jedes Mitglied hat bei Instagram einen Benutzernamen, unter dem es auch dort zu finden ist. Das bedeutet, die Mitglieder verbinden sich miteinander, indem sie anderen folgen, ihre Beiträge ansehen und diese gegebenenfalls „liken“. Außerdem kann man Beiträge anderer kommentieren. Die App entstand 2010, das Unternehmen wuchs schnell und wurde schließlich von Facebook 2012 für ca. eine Milliarde US-Dollar aufgekauft. Die Zahl der Nutzenden liegt mittlerweile bei über 300 Millionen.
Warum besitzt fast jeder ein Instagram-Account und warum verbinde ich mit Instagram sofort Fake-Accounts?
Bei der Suche nach meinem digitalen Objekt ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, welche Social Media App ich am meisten nutze. Es gibt zahlreiche Apps, die ich auf meinem Handy besitze und verwende, doch keine ist von mir so häufig genutzt wie Instagram.
Ich besitze selbst einen Instagram-Account und kann mir mein Leben kaum mehr ohne die Möglichkeit vorstellen, Instagram zu nutzen. Täglich schaue ich nach neuen Inspirationen für Restaurants, Ausgehmöglichkeiten, Outfits und vielem mehr. Mir fällt oft gar nicht selbst auf, wie viel Zeit ich damit verwende, meine Tweets durchzugehen und zu stöbern. Es macht Spaß mit Freunden Fotos zu teilen, zu kommunizieren und zu surfen. Instagram bietet auf allen Ebenen und jedem die Möglichkeit seine Zeit zu vertreiben und zu surfen!
Jedoch verbinde ich mittlerweile auch mit Instagram Druck auf mich selbst durch die ständig perfekt gestylten Menschen. Es gibt keine offizielle Diagnose, die lauten würde: Social-Media-Abhängigkeit. Doch Bilder, die von mir gepostet werden und mit „Likes“ versehen worden sind, aktivieren ein Belohnungssystem im Gehirn. Das ist sicherlich ein Grund, warum Leute immer wieder auf die Plattformen zurückkehren, um „Likes“ zu bekommen, das fühlt sich gut an. Wir vergleichen uns immer mehr. Bei manchen Personen kann das zu einem negativen Effekt führen.
Ich habe mal in meiner Familie nachgefragt, was früher zu deren Zeit vergleichbare Dinge waren. Die Antwort lautet: Fotoalben.
Über viele Jahre hinweg wurden die schönsten Momente in Fotoalben hineingeklebt und damit Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. So ist ein Fotoalbum als Erinnerungsstück schwer zu ersetzen. In ein Fotoalbum werden nur die liebevoll gestalteten Bilder geklebt, man findet selten ein Fotoalbum mit Bildern auf denen Traurigkeit, Wut oder Negativität zu sehen sind. Ich sehe hier Parallelen zu Instagram. Die Nutzer*innen achten darauf, dass ihre Bilder mit Filtern und Bearbeitungen gepostet werden, weil alles perfekt erscheinen muss.
Ich erkenne durch den Wandel der Digitalisierung Chancen und Risiken für uns selbst.
Wir entscheiden bewusst, was wir herausstellen möchten. Wie wir uns beschreiben und welche Fotos dieses Selbstbild unterstreicht. Zugleich gibt es bei Instagram auch Fake-Accounts. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mich Fake-Profile anschreiben, meine Bilder liken oder sogar aufdringlich werden. Hinter dem Account verbirgt sich ein Mensch, der vorgibt eine andere reale oder fiktive Person zu sein. Solche Accounts werden meist erstellt, um die wahre Identität zu verschleiern. Man besitzt die Möglichkeit sein Profil privat zu verwalten, sodass nur deine Freunde deine Posts sehen können. Ich stelle mir oft die Frage, wer mit welchen Grund bei meinem öffentlichen Account meine Posts sieht. Und dann denke ich an das Gefühl von Sicherheit, das ein privates Profil verspricht.
Es gibt öffentliche Profile, die haben viele Fans: die von Influencer*innen. Auch Unternehmen haben die Beliebtheit der Influencer*innen bereits erkannt und nutzen diese für ihr Marketing. So ist es nichts Besonderes mehr, wenn ein Influencerin Werbung für ein Shampoo, eine Haarbürste oder für Klamotten macht. Dies scheint für die meisten Unternehmen sehr lukrativ zu sein. Aber was wäre, wenn Bibi und Co im realen Leben gar nicht existieren würden? Was ist, wenn Marken wie Gucci, Louis Vuitton oder bestimmte Kosmetikmarken ihre Werbung mit gefälschten Aufnahmen machen würden? Ist das eigenartig? Oder sogar interessant, unvorstellbar und gar nicht möglich? Egal in welcher Form, mit Fake-Accounts, die es immer geben wird, muss man zurechtkommen und versuchen, sich nicht davon beeinflussen zu lassen.
Ein Grund, warum ich einen Instagram-Account besitze, ist ein gesellschaftlicher Zwang, das Gefühl eventuell nicht mitreden zu können. Als ob eine Art Sucht dahinter steckt, täglich auf Instagram zu sein. Ich spüre allerdings keinen großen Druck, so auszusehen wie manche Frauen auf Instagram. Natürlich beneide ich die eine oder andere um ihren Urlaub, ihre Taschen oder sonstige Gadgets. Dennoch bleibe ich mir treu auf Instagram und versuche, mein persönliches Empfinden vor negativen Auswirkungen zu bewahren.
Digitale Gesprächsräume.
Seminar im Sommersemester 2020 an der Goethe Universität Frankfurt.
Tutorin: Nele Oeser
Dozentin: Tine Nowak (Museum für Kommunikation Frankfurt)

von Tine Nowak | Jul 16, 2020 | Allgemein
Im Rahmen des Seminars zu “Digitalen Gesprächsräume” im Orientierungsstudium der Goethe Universität Frankfurt sind Essays zur subjektorientierter Erzählung von digitalen Praxen und Phänomenen entstanden. Mehr dazu findet sich auf der Überblicksseite: Digitale Gesprächsräume.
Kommunikation und Diskurs
Essay von Thi Bich Phuong Dang
Wie erfolgreich ist diese neuartige Kommunikationsform wirklich?
Ich könnte mir kaum vorstellen, wie sehr ich in Deutschland unter Einsamkeit und Heimweh leiden würde, wenn keine digitalen Kommunikationsmedien in der Welt vorhanden wären. Danke Messenger und Internet kann ich trotz der räumlichen Distanz jederzeit mit meinen Freunden und meiner Familie in Heimatland kommunizieren.
Ich habe mich gefragt, wie die menschliche Kommunikation früher ohne Soziale Netzwerke lief. Mit meinen älteren Verwandten habe ich darüber diskutiert. Briefe, Postkarten und Festnetztelefon, Telefaxe waren laut meiner Eltern und Großeltern vor dem Medieneinsatz meistbenutzte Kommunikationstools, mit denen sie gleichwohl nur bestimmte Dinge austauschen konnten. Diese Medien, die heutzutage weniger in Anspruch genommen werden, kosten nach ihrer Ansicht wesentlich viel Geld und Zeit. Und sie haben sie sich zudem öfter zu Hause oder im Café getroffen, um persönlich miteinander zu reden.
Durch die Digitalisierung verlassen wir immer mehr diese klassische Formen der Kommunikation. Wir leben mitteleweile in einem digitalen Zeitalter, in dem nahezu alle ein eigenes Smartphone mit Internetzugang besitzen. Unsere Kommunikationswege haben sich ebenfalls drastisch verändert. Die digitalisierte Welt ermöglicht es, dass wir uns miteinander auf den kostenlosen Online-Kommunikationsplattformen, wie z.B. Facebook, Skype, WhatsApp, etc. jederzeit und überall in Verbindung setzen zu können, solange wir eine stabile Verbindung zum Internet und den Endgeräten haben.
Im Vergleich versendet ein Messenger eine digitale Nachricht in der Regel nahezu im Augenblick, während handgeschriebene Briefe früher u.U. wochenlang unterwegs waren. Nur mit einer App oder direkt auf der Internetseite von Facebook haben wir schon die Möglichkeit eines zeit- und ortsunabhängigen Austausches der Text-, Bilder- und Video-Nachrichten. Daneben können wir damit auch zuverlässig Sprach- und Videoanrufe durchführen.
Der Umgang mit diesen digitalen Medien sowie mit dem Handy und ihre Bedienung sind zwar nicht anspruchsvoll, jedoch setzen sie bestimmte Technik- und Medienkompetenzen, die für ältere Menschen große Herausforderung sind, voraus. Messenger zusammen mit den anderen digitalen Kommunikationsmedien sind meinen Großeltern unbekannt, obwohl sie auch Handy haben.
Trotz der Tatsache, dass die neuen Kommunikationsarten uns zahlreiche Vorteile bieten, bringt die Mediennutzung auch Risiken mit sich. Wie gut sind meine persönlichen Daten geschützt? Wie sollte ich mit Betrug im Internet umgehen? Um Sicherheitslücken sowie Hackerangriffe auf Social-Media-Konten sorgen sich manche User*innen. Auch die Übermittlung von personenbezogenen Daten im Internet muss bedacht werden. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir über Zeitbeschränkungen beim Medienkonsum oder eine strengere Trennung von virtuellem und realem Treffen nachdenken. Dass muss aber jede*r individuell für sich entscheiden, je nachdem, wie oft die Sozialkontakten außerhalb der virtuellen Welt noch gepflegt werden.
Doch selbst mit den besten Datenschutzrichtlinien, glaube ich nicht, dass der reale Kontakt durch den Medieneinsatz ersetzt werden kann. Einerseits empfinde ich persönlich Kommunikation per Messenger sowie auf anderen Online-Plattformen als vorteilhaft, weil ich dadurch mein Heimweh immerhin zum Teil überwinden kann. Andererseits vermisse ich immer noch persönlichen Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden trotz unseres ständigen Verbundenheitsgefühls. Seit langem sehne ich mich nach den liebevollen Umarmungen meiner Eltern, den sanften Stimme meiner Großeltern und nach der warmen familiären Atmosphäre, die ich nirgendwo anders, außer in meinem Elternhaus fühlen kann. All dies kann niemals durch Medien wie Handys erfüllt werden.
Die digitalen Kommunikationsformen können keineswegs Ersatz, sondern nur Ergänzung für die klassische und insbesondere physische Kommunikation sein.
Digitale Gesprächsräume.
Seminar im Sommersemester 2020 an der Goethe Universität Frankfurt.
Tutorin: Nele Oeser
Dozentin: Tine Nowak (Museum für Kommunikation Frankfurt)
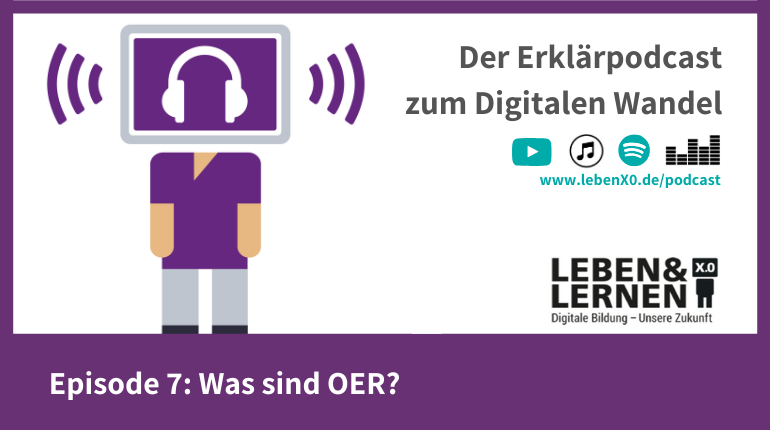
von Tine Nowak | Jan 31, 2020 | Podcast
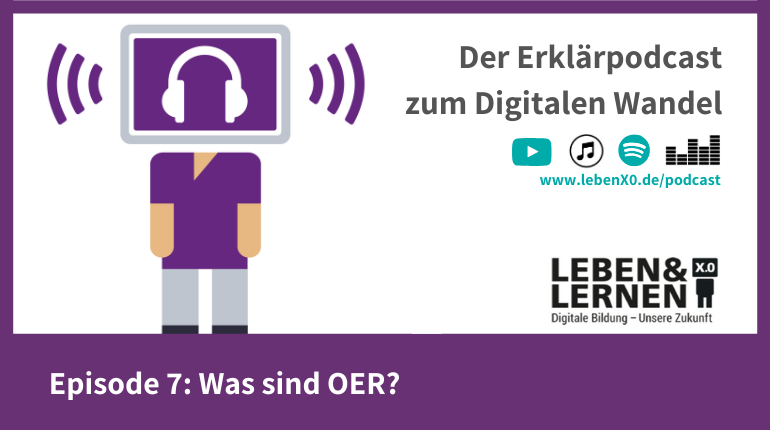
Der Erklärpodcast zum Digitalen Wandel widmet sich zentralen Begriffen der Digitalisierung: Von A wie Algorithmen bis S wie Social Scoring reicht das Themenspektrum. Der Podcast ist Teil des Dialogprojekts “Leben & Lernen X.0” am Museum für Kommunikation Frankfurt, in dem im Dialog mit der Bürgerschaft Fragen zur Zukunft der Bildung, Arbeit und Demokratie verhandelt werden.
“Was sind OER?” fragt Tine Nowak als Gastgeberin des Leben X.0-Podcasts. Als Co-Moderator ist dieses Mal Stefan Jahrling dabei, er arbeitet als Medienpädagoge am Museum für Kommunikation Berlin. Nach einem Blick in die Wikipedia entfalten drei Expert*innen den Begriff der Open Educational Resources (OER) aus unterschiedlichen Blickrichtungen: Anja Lorenz (TH Lübeck) führt grundlegend in den Begriff ein, Lawrence Lessig (Harvard Law School & Harvard University) blickt zurück, als Creative Commons gegründet wurden und Christian Friedrich (Wikimedia Deutschland) spricht über den Nutzen von OER gerade für Lernen in einer digital geprägten Welt.
Die folgenden Kapitel lassen sich im Player direkt ansteuern, wenn man im Player (oben) über “Alle Episode” das Icon ganz links anklickt, damit öffnet sich das Kapitelverzeichnis.
00:00:39 Einstieg mit Stefan Jahrling
Stefan Jahrling ist Medienpädagoge am Museum für Kommunikation Berlin. Er befasst sich da mit klassischer Museumspädagogik, allerdings mit einem medienpädagogischen Fokus: dem Einsatz von Medien in der Vermittlung, Medienkompetenzförderung, sowie Themen wie Cybermobbing oder Fake News. Museen versteht er als Orte der Bildung.
00:03:44 Podcast-Konzept
Der Podcast erläutert in jeder Episode ein Schlagwort der Digitalisierung. Die Begriffe wurden durch ein Publikumsvoting ermittelt. Immer eine* andere* Museumskollegin oder ein -kollege aus der Museumsstiftung ist als Co-Moderation dabei, zudem wird der Begriff in der Wikipedia nachgeschlagen und es gibt Erläuterungen von drei verschiedenen Expert*innen.
00:05:01 Begriffsklärung OER
Stefan Jahrling beschreibt OER als freie Bildungsmaterialien, die zur Nutzung frei gestellt wurden. Er selbst verwendet auch OER, diese sind gerade im Bereich Medien und Medienpädagogik sinnvoll, weil das Thema ständig im Wandel ist.
00:06:37 Wikipedia: Open Educational Resources
In allen Episoden wird als Ausgangspunkt des Podcasts der erste Absatz des Wikipedia-Artikels zum Thema – OpenEducational Resources – vorgelesen. In diesem Fall ist es jedoch nur ein Auszug, da der ganze Absatz etwas länger ist. In dem Absatz werden OER als freie Lern- und Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz beschrieben, als Anwendungsfelder werden zunächst die Fern- und Hochschulbildung benannt. Etwas überraschend erscheint der prominente Verweis auf Reputationsarbeit als Motiv der Autor*innen, da von Stefan Jahrling und Tine Nowak die Community stärker von Aktivismus und dem Sharing-Gedanken geprägt erlebt wird. Die Wikipedia ist ein weitverbreitetes Beispiel für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen, und kann durch dieses Lizenzmodell selbst als offene Bildungsresource genutzt werden.
00:11:08 Anja Lorenz
Anja Lorenz ist Online-Redakteurin und MOOC-Makerin am Institut für Lerndienstleistungen der Technischen Hochschule Lübeck. Dort finden sich u.a. auch Onlinekurse zu OER statt (z.B. #COER16). Zudem ist sie die eine Hälfte des BildAltEntf-Podcasts. Sie erläutert, dass OER-Bildungsmaterialien verschieden sind: das können Arbeitsblätter, Videos oder ganze Kurse sein. Das O steht für Open also offen, das heißt zumeist kostenlos und frei zugänglich. Der englische Begriff der Open Educational Resources hat sich auch in Deutschland durchgesetzt, er ist durch den internationalen Diskurs geprägt worden. Eingeführt wurde der Begriff OER 2002 in einem Abschlussbericht der UNESCO, in dem stand, dass Bildungsmaterialien im Idealfall offen und frei und für alle nutzbar sein sollten. Diese OER können in allen Bildungsbereichen eingesetzt werden, sowohl in der informellen Bildung als auch in den Schulen oder Hochschulen. Anja Lorenz würde zum Start von OER drei Dinge vorschlagen: 1) den MOOC zum OER-Fachexpert*innen #OERexp, der im März 2020 neu startet. 2) Die Webseite der OER Infostelle: https://open-educational-resources.de. 3) Und zuletzt eines der OER Camps, die nächsten finden im Februar und März 2020 in Berlin und Bonn statt. Als weitere Quellen und Orte von OER ergänzt Stefan Jahrling z.B. das Medienpädagogok-Praxis Blog und die Medienpädagogik-Praxis Camps.
00:31:12 Lawrence Lessig
Lawrence Lessig gehört zum Gründungs-Team der Creative Commons-Lizenzen. Er Professor für Rechtswissenschaften (Harvard Law School und Harvard University). Er berichtet von den Anfängen der Creative Commons (CC). In den frühen Jahren, so um Jahr 2002/03 erlebte er das Web als von “Urheberrechts-Kriegen” geprägt, mit polarisierenden Positionen von Urheberrechts-Extremist*innen und Urheberrechts-Anarchist*innen. Die Creative Commons-Lizenzen brachten eine Alternative ins Spiel. Die Innovation in der Arbeit an den Lizenzen selbst beschreibt Lessig als vergleichweise langweilig, wenn man die Möglichkeiten in der Anwendung betrachtet. Die Wissenschafts- und Bildungs-Communities testeten die neuen Lizenzen in aufregenderen Bereichen aus. Der Einsatz von CC-Materialien veränderte das Lehr-/Lern-Setting. Lehrmaterialien selbst zu erstellen und verändern zu können hat die Art zu Lehren geprägt. Die CC-Lizenzen waren nicht die ersten freien Lizenzen: die Free Software Foundation und Open-Source-Bewegung war hier schon vorab aktiv. Doch diese Lizenzen eignen sich besser für Software und weniger gut für kulturelle Erzeugnisse. Die Herausforderung bestand darin, so Lessig, ein Umfeld zu fördern, dass die Menschen dazu ermutigte, Dinge zu tun, die niemand zuvor geplant hatte. Diese Innvationsfreiheit sei ein Grundpfeiler des freien Internets, die er durch geschlossene Plattformen wie z.B. Facebook bedroht sieht. Das freie Internet sei wichtig für die Freiheit der Bildung.
Disclaimer: Das Gespräch mit Lessig fand am 12.9. in der Wikimedia statt. Wir empfehlen den zur Netzpolitik-Tagung aufgenommenen Netzpolitik-Podcast zu hören, in dem sich Lessig u.a. zu einem am 14.9. in der New York Times veröffentlichten Interview äußert. Die im Podcast thematisierten Äußerungen Lessigs zum MIT und den von dort angenommenen Epstein-Spenden werden bis heute kritisch diskutiert. Beim Podcastgespräch war dieser Diskurs uns selbst nicht präsent gewesen, sie blieb somit nicht wissentlich unerwähnt.
00:55:57 Christian Friedrich
Christian Friedrich ist Referent für Bildung und Wissenschaft bei der Wikimedia in Deutschland, außerdem ist er freiberuflich im Bereich Bildung & „Open Educational Resources“ tätig. Er ist zudem Podcast-Gastgeber und Teil des „Feierabendbier Open Education“-Podcasts. Er beschreibt OER als eines der Kernthemen für Wikimedia Deutschland und OER als freie Bildungsmaterialien sind somit Teil seiner Arbeit. Dabei ist für ihn der Aspekt der Öffnung von Bildung immens wichtig. Martin Weller (Open University) spricht von der Wikipedia als eine der ersten Open Education Resources. Das Problem, dass dem allem eigentlich zugrunde liegt ist jedoch das Urheberrecht, das nicht mehr zeitgemäß ist, gerade wenn es um Bildungsmaterialien geht. OER seien nicht Selbstzweck, sondern derzeit notwendige Krücken. Nicht überall ist das Urheberrecht der Hauptmotor für offene Bildungsmaerialien. In einer globalen Perspektiven kommen Faktoren wie Ungleichheit hinzu, für die OER einer der Lösungswege sein kann. Er fragt sich mit Blick auf das deutsche Bildungssystem, warum so wenig Bildungsmaterialien öffentlich finanziert werden. Es gäbe ein Ungleichgewicht in Hinblick auf kommerzielle Anbieter, was gar nicht bedeutet solle, dass Bildung umsonst sein müsse oder nichts kosten dürfe, nur die Kosten müssten anders verteilt werden. Und man müsse generell öffentlich über eine Haltung zu digitaler Bildung und Lernen digital nachdenken.
01:17:14 Resümee
Stefan Jahrling resümmiert, dass Bildungsarbeit und Bildungspolitik hier stärker gefordert sein sollten: in Bildung müsse stärker investiert werden. Creative Commons und freie Bildungsmaterialien sieht er als Riesenchance, um Bildung voranzubringen. Auch wenn OER für ihn persönlich kein neues Thema sind, hat ihn im Verlauf der Episode der Gedanke beschäftigt, dass es bei seiner eigenen Arbeit im Museum großes Potential gibt, in Richtung offener Bildungsmaterialen zu arbeiten. Wichtig scheint ihm auch – gerade aus den Reihen der Museen – dass man politisch forden müsse, dass Bildungsarbeit kostet und verweist dabei auf ein Zitat von Derek Bok (Havard University): “If you think education is expensive, try ignorance”.
01:20:40 Abschied
Wir verweisen bei der Gelegenheit gleich noch auf die nächste Episode zu: Was ist Arbeit 4.0?
01:21:25 Extra track: Lawrence Lessig and OER (in english)
The interview with Lawrence Lessig took place on 12th of September at Wikimedia Germany: Lawrence Lessig is part of the founding team of Creative Commons Licenses. He is Professor of Law (Harvard Law School and Harvard University). He reports on the beginnings of the Creative Commons movement. In the early years, around 2002/03, he experienced the Web as being marked by “copyright wars”, with polarizing positions of copyright extremists and copyright anarchists. The Creative Commons licenses brought an alternative into play. Lessig describes the innovation in the work on the licenses themselves as comparatively boring when one considers the possibilities in application. The scientific and educational communities tested the new licenses in more exciting ways. The use of CC materials changed the teaching and earning setting. Being able to create and modify educational materials yourself has shaped the way teaching is done. The CC licenses were not the first free licenses: the Free Software Foundation and Open Source movement had been active in this area before. But these licenses are more suitable for software and less suitable for cultural products. The challenge, according to Lessig, was to foster an environment that encouraged people to do things that no one had ever planned for. This freedom of innovation is a cornerstone of the free Internet, which he sees threatened by closed platforms and ‘walled gardens’ such as Facebook. The free internet is important for the freedom of education.
Disclaimer: We recommend in this context listening to the Net Politics Podcast (NPP 184) recorded at the Netzpolitik Conference in Berlin, in which Lessig comments on his Medium article and an interview published in the New York Times on 14th of September. Lessig’s comments on MIT and the Epstein donations accepted by MIT are still being critically discussed.
Gibt es zu der Episode noch offene Fragen oder Ergänzungen? Dann schreibt uns per Mail oder Twitter (@mfk_frankfurt mit Hashtag #LebenX0). Wenn die Episode oder der Podcast Euch gefallen hat, dann könnt Ihr uns mit einer Bewertung oder Rezension bei iTunes eine Freude machen.
Ein Podcast des Museums für Kommunikation Frankfurt (Museumsstiftung Post und Telekommunikation).
Gäste: Anja Lorenz, Lawrence Lessig und Christian Friedrich
Co-Moderator: Stefan Jahrling
Redaktion/Produktion: Tine Nowak
Sprecher Lessig: Marc Rodriguez
Lizenz: CC-BY SA 4.0
Intro-Musik: “F” by Initials DC (mit freundlicher Genehmigung).
Remix mit Tonfragmenten aus der Sammlung der MSPT durch Uvo Pauls.
Autorin: Tine Nowak

von Tine Nowak | Nov 30, 2019 | Podcast

Der Erklärpodcast zum Digitalen Wandel widmet sich zentralen Begriffen der Digitalisierung: Von A wie Algorithmen bis S wie Social Scoring reicht das Themenspektrum. Der Podcast ist Teil des Dialogprojekts “Leben & Lernen X.0” am Museum für Kommunikation Frankfurt, in dem im Dialog mit der Bürgerschaft Fragen zur Zukunft der Bildung, Arbeit und Demokratie verhandelt werden.
Mit der sechsten Episode ist die Halbzeit der Staffel erreicht. Gastgeberin des Leben X.0-Podcasts Tine Nowak fragt: Was ist Maschinelles Lernen? Als Co-Moderatorin ist dieses Mal Anne-Marie Bernhard dabei, sie arbeitet im Archiv und in der Bibliothek des Museums für Kommunikation Frankfurt. Nach einem Blick in die Wikipedia entfalten drei Expert*innen den Begriff des Machine Learnings aus unterschiedlichen Blickrichtungen: Gudrun Thäter (Mathematikerin, KIT), Dirk Primbs (Developer Relations, Google) und Ralf Stockmann (Innovationsmanagement, Staatsbibliothek zu Berlin) führen in Maschinelles Lernen und Mustererkennung ein und skizzieren spezifische Anwendungungsgebiete.
00:00:39 Einstieg mit Anne-Marie Bernhard
In jeder Episode ist eine andere Museums-Kollegin oder ein -Kollege als Co-Moderation dabei. In dieser Episode ist es Anne-Marie Bernhard. Sie arbeitet im Bereich Archiv und Bibliothek und kümmert sich vor allem um die Neukonzeption des Archivs sowie Fragen der Langzeitarchivierung, Zugänglichkeit und Erschließung von Archivalien.
00:03:49 Podcast-Konzept
Der Leben x.0-Podcast erläutert in jeder Episode ein Buzzword der Digitalisierung, die Begriffe wurden durch Publikumsvoting ermittelt. Immer eine* andere* Museumskollegin oder ein -kollege aus der Museumsstiftung ist als Co-Moderation dabei, zudem wird der Begriff in der Wikipedia nachgeschlagen und es gibt Erläuterungen von drei verschiedenen Expert*innen.
00:05:53 Maschinelles Lernen
Machine Learning
00:07:16 Wikipedia: Maschinelles Lernen
Die Wikipedia als Nachschlagwerk für Viele ist der Startpunkt bei der Frage nach dem Maschinellen Lernen. Wie wird das Phänomen dort geschildert? Tine Nowak liest den ersten Absatz des: Wikipedia-Artikels zu Maschinellen Lernen vor.
00:11:07 Expert*innen der Episode
Gudrun Thäter (Modellansatz-Podcast), Dirk Primbs (Anerzählt) und Ralf Stockmann (Ultraschall)
00:12:29 Gudrun Thäter
PD Dr. Gudrun Thäter ist Mathematikerin am KIT, sie arbeitet am Institut für Angewandte und Numerische Mathematik. In der Episode bietet sie eine Definition des Machine Learnings an, die sich am Begriff des Lernens orientiert. Mustererkennung ist eine der Aufgaben des Maschinellen Lernens. Das Lernen basiert auf einem künstlichen Neuronalen Netz. Sie nennt Anwendungungsbsp. aus der Medizin und von unterschiedlichen Mobilitäts-Modellen. Die Text- und Spracherkennung ist ein wichtiges Zukunftsfeld, die Bilderkennung in Videobildern macht hingegen nicht wünschenswerte Überwachungsszenarien denkbar (aktuell schon Gesichterkennung am Bahnhof Berlin-Südkreuz).
00:36:40 Dirk Primbs
Dirk Primbs arbeitet in Frankfurt im Bereich der Developer Relations für Google, das ist eine Kontaktstelle zur Entwicklercommunity. Ausgehend von der Mustererkennung, berichtet er, dass es für Programmierer*innen immer einfacher wird, Machine Learning Anwendungen einzusetzen. Datenschutz ist ein Thema für die Nutzer*innen, viele Dienste laufen mittlerweile auf unseren Smartphones (Z.B. Fotoverarbeitung der Smartphone-Kamera) ohne, dass Daten in der Cloud an die Server der großen Technologieunternehmen gesendet werden.
00:59:50 Ralf Stockmann
Ralf Stockmann ist Referatsleiter für Informations- und Datenmanagement an der Staatsbibliothek zu Berlin. Zielsetzung des Referates ist die Generierung und praktische Umsetzung von Innovationen im Bereich der digitalen Informationsdienstleistungen. Zu KI und Maschinellem Lernen gibt es von ihm einen lohnenswerten Vortragsmitschnitt: Der Zauberlehrling ist nicht als Anleitung gedacht. Im einem Projekt zu automatisierten Kuratierungstechnologien für das digitalisierte kulturelle Erbe arbeitet er mit Informatikern gemeinsam an der Konzeption, Implementierung und Evaluierung von Softwarekomponenten zur semantischen Analyse, Inhaltsanreicherung und Profilierung der digitalisierten Bestände der Staatsbibliothek.
01:22:47 Resümee
Resümee
01:28:26 Ausblick
Nächste Episode: Was ist OER?
Gibt es zu der Episode noch offene Fragen oder Ergänzungen? Dann schreibt uns per Mail oder Twitter (@mfk_frankfurt mit Hashtag #LebenX0). Wenn die Episode oder der Podcast Euch gefallen hat, dann könnt Ihr uns mit einer Bewertung oder Rezension bei iTunes eine Freude machen.
Ein Podcast des Museums für Kommunikation Frankfurt (Museumsstiftung Post und Telekommunikation).
Gäste: Gudrun Thäter, Dirk Primbs und Ralf Stockmann
Co-Moderatorin: Anne-Marie Bernhard
Redaktion/Produktion: Tine Nowak
Lizenz: CC-BY SA 4.0
Intro-Musik: “F” by Initials DC (mit freundlicher Genehmigung).
Remix mit Tonfragmenten aus der Sammlung der MSPT durch Uvo Pauls.
Autorin: Tine Nowak


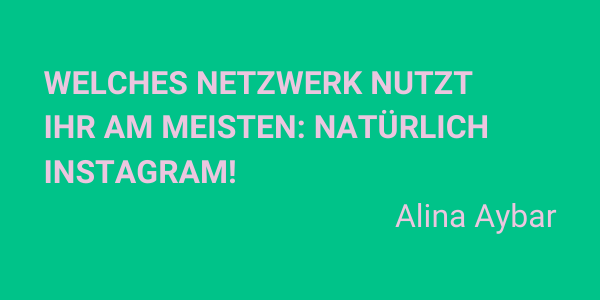
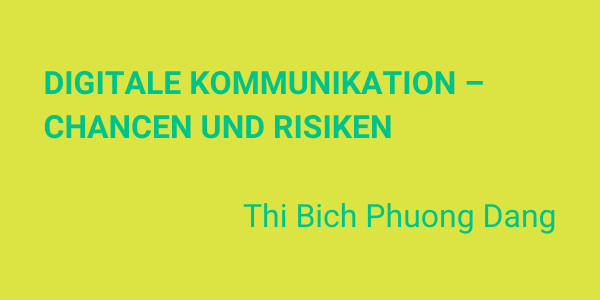
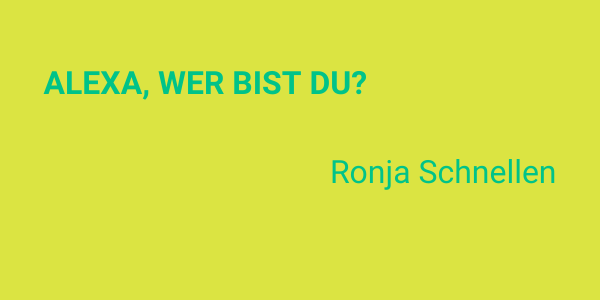

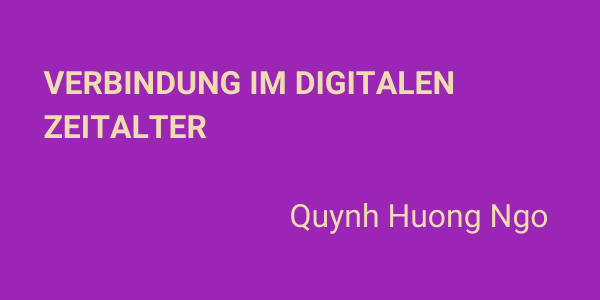
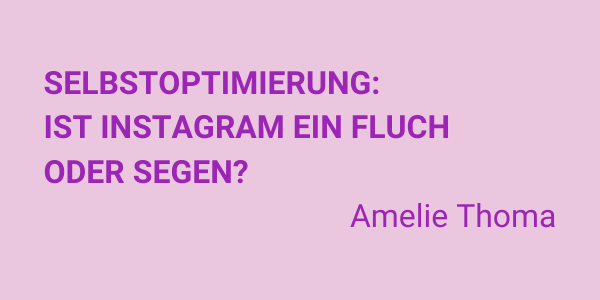
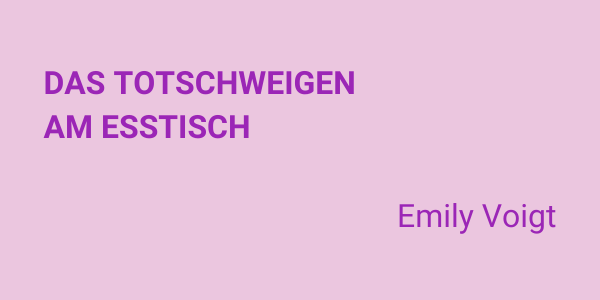
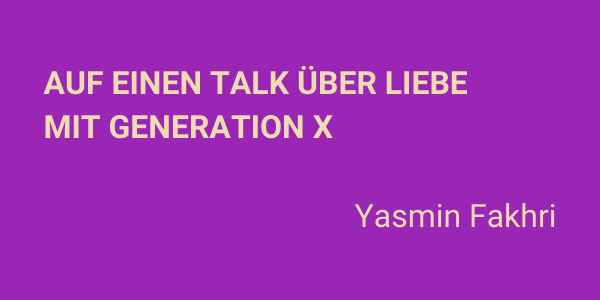
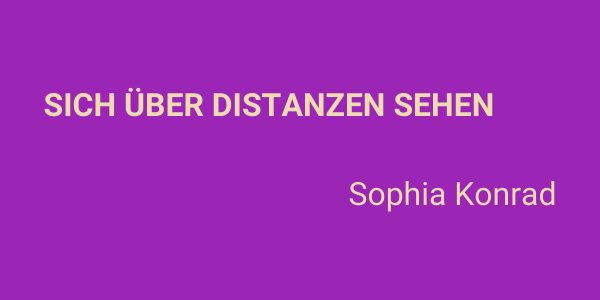
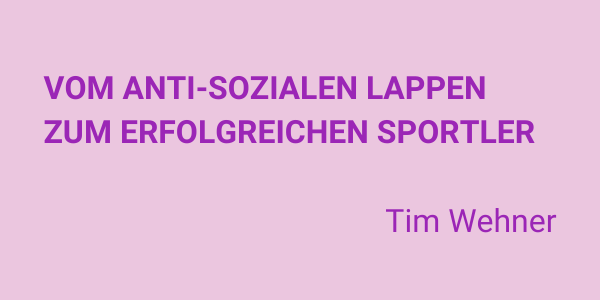
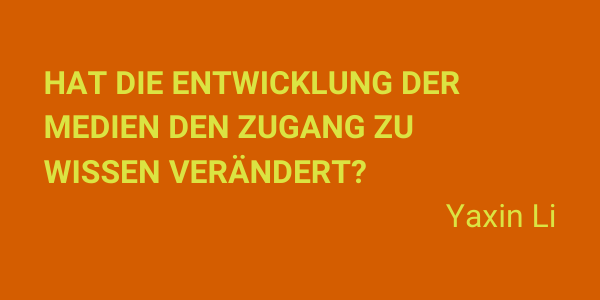
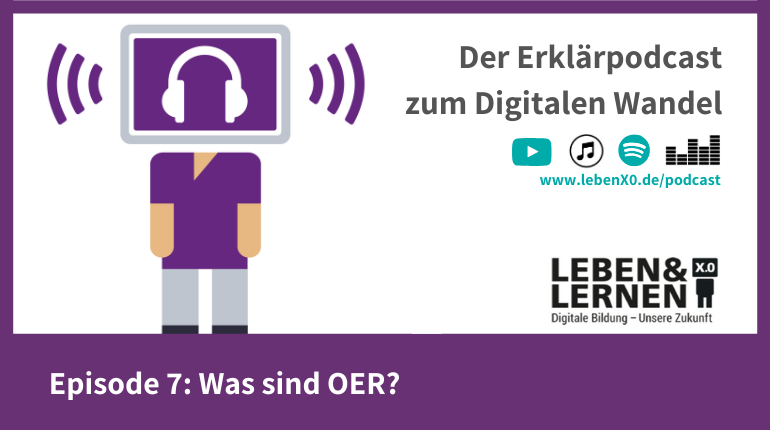

Neueste Kommentare